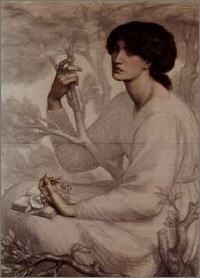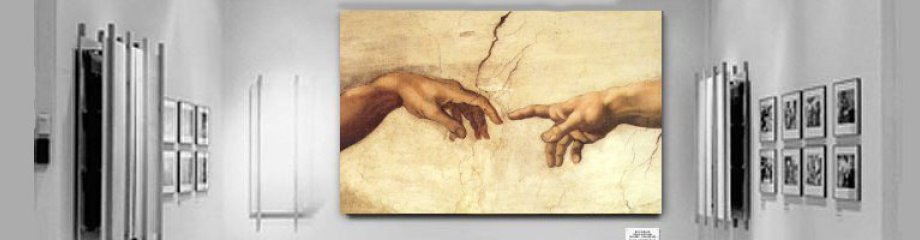
Imaginationstherapie
Imaginieren: sich vorstellen, bildhaft, anschaulich machen) ist eine alte bewusst eingesetzte Methode zur Veränderung des Bewusstseins und zur Herstellung einer Beziehung zu unbewussten Inhalten.
Schon in frühen Höhlenmalereien lassen sich Nachweise für Tagträume finden. Auch in uralten Heilungsritualen spielen Tagträume eine große Rolle, sie werden genutzt u.a. bei den Schamanen, um in
Kontakt mit den eigenen Krafttieren zu kommen und inneren Ausgleich und Heilung zu erfahren. Tagträume sind Ausdruck von Kreativität und fördern das Denken. Das Gehirn nutzt bei den Tagträumen freie
Kapazitäten für Gedanken, die uns beschäftigen. Tagträume können uns zu unserem eigen Selbst führen, unabhängig von den Vorgaben der anderen, sie tragen bei zur Persönlichkeitsbildung und zur
seelischen Gesundheit. Nach Ergebnissen der Hirnforschung haben innere Bilder eine lebenswichtige Funktion. In der modernen Traumatherapie steht daher auch die Imaginationstherapie im Vordergrund der
Behandlung um z.B. einen „Inneren sicheren Ort“ herzustellen. In der Imagination wird nach der Theorie von C.G. Jung erlebte Wirklichkeit zu einem Symbol, und gleichsam zu einem Mittelbereich
zwischen konkret erlebter Wirklichkeit. In der Verbindung zu unserem psychischen Hintergrund gelangen wir dann auch zu einer Einsicht in die uns prägenden Beziehungen und unsere aktuellen
Beziehungsmuster. Hanscarl Leuner, der eine eigenständige psychoanalytisch fundierte Imaginationsmethode entwickelte spricht in diesem Zusammenhang von der Arbeit mit dem Tagtraum bzw. dem Katathymen
Bilderleben (Katathym Imaginative Psychotherapie). Weitere Ansätze hier liefern die grundlegenden Arbeiten von C.G. Jung (Verena Kast), der den Begriff der „Aktiven Imagination“ verwendet.
Die Nähe dieses Verfahren zur Kunstpsychologie besteht darin, dass viele Künstler Ihre Tagträume bildnerisch umgesetzt haben, um sich dadurch auch psychisch zu entlasten.
In der Imaginationstherapie wird der Patient mittels einer Körperentspannung eingeladen, vorgegebenen bzw. freien Bildermotiven mit geschlossen Augen zu erleben. Hanscarl Leuner (Leuner
1990, S. 39) stellt fest, dass zwischen imaginärem Inhalt und unbewussten dynamischen Strukturen des Subjekts eine funktionelle Einheit besteht.
Die Arbeit mit Bildern ist eine Form der indirekten Kommunikation. Es gibt viele Parallelen zur Hypnosetherapie (Bongartz 2000, S. 219 ff) und der Imaginationstherapie (Reddemann 2001, S. 15 ff).
Luise Reddemann (Reddemann 2001, 17) beschreibt, dass der Einsatz von Ich-stabilisierenden imaginativen Techniken der Stärkung und dem Aufbau von Ich-Funktionen dient. Bongartz (Bongartz 2000, S.
220) spricht davon, das die symbolische Behandlung die Bearbeitung von belastenden Erfahrungen ermöglicht, ohne dass die Therapeutin die Ursache dieser Belastung kennen muss. Dabei wird das
Problem/Symptom symbolisiert und die Auseinandersetzung mit dem Problem/Symptom findet über die Auseinandersetzung mit dem Symbol statt.
Gleichzeitig ist es auch möglich diesen imaginären Raum dann in einem tatsächlichen Bild oder in einem schriftlichen Text auszudrücken.
Georg Franzen
Weitere Informationen:
- Katathym Imaginative Psychotherapie
- Deutsche Gesellschaft für Analytische Psychologie (DGAP)
- C.G. Jung -Gesellschaften
- Deutsche Gesellschaft für Hypnose
- Katathym Imaginative Psychotraumatherapie
- Kursleiter Autogenes Training/Kunsttherapie
Literatur:
- Bongartz, B. u.W.. (2000). Hypnosetherapie. Göttingen; Hogrefe.
- Flügge, D. (2007). Im Dialog mit der Seele. Die Angeleitete Aktive Imagination (AAI). Band 1.Norderstedt: Books on Demand.
- Ernst, Heiko (2011). Innenwelten. Warum Tagträume uns kreativer, mutiger und gelassener machen. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Franzen, Georg (2006). Ein Tagtraum des Malers Date Gabriel Rossetti. In: Imagination Nr.1/2006, S.76-88. Wien: Facultas.
- Franzen, G. (2009). (Hrsg.). Katathymes Bilderleben und künstlerische Therapien. Mit Beiträgen von Georg Franzen, Ruth Hampe, Karin Nohr u. Harald Ullmann. Themenheft. Musik-,Tanz-und Kunsttherapie,2009,4, Göttingen: Hogrefe.
- Franzen, G. (2010). Trance mit Michelangelo. Klinische Hypnose und rezeptive Kunsttherapie. In: Suggestion,2010,1,S.6-15.Coesfeld:DGH.
- Hüther,G. (2005). Die Macht der inneren Bilder. Wie Visionen das Gehirn und die Welt verändern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Kast, Verena (1995). Imagination als Raum der Freiheit. Dialog zwischen Ich und Unbewusstem. München: DTV.
- Kottje-Birnbacher,L./Sachsse, U./Wilke. E. (2010). Psychotherapie mit Imaginationen. Mit einem Vorwort von Gerald Hüther.Göttingen: Hans Huber.
- Krucker, Wolfgang (1995). Partner der Innenwelt. Analytische Imaginationstherapie. Düsseldorf: Walter
- Leuner Hanscarl u. Wilke E. (2005). Katathym - Imaginative Psychotherapie. Stuttgart: Thieme.
- Reddemann, L. (2001). Imagination als heilsame Kraft. Zur Behandlung von Traumafolgen mit ressourcenorientierten Verfahren. Stuttgart: Klett-Cotta
- Seifert, A./SeiferTh./P.Schmidt (2003). Der Energie der Seele folgen. Gelassen und frei durch Aktive Imagination. Düsseldorf: Walter.
- Steiner B. u. Krippner K (2006) Psychotraumatherapie Tiefenpsychologisch-imaginative Behandlung von traumatiserten Patienten. Stuttgart: Schattauer
- Salvisberg H./Stigler M./Maxeiner V. (Hrsg) (2000).Erfahrungen träumend zur Sprache bringen. Grundlagen und Wirkungsweisen der Katathym-imaginativen Psychotherapie. Göttingen: Hans Huber
- Ullmann, Harald (Hrsg.). (2001). Das Bild und die Erzählung in der Psychotherapie mit dem Tagtraum. Zwölf Fallgeschichten. Göttingen: Hans Huber.
- Ullmann, Harald u. Wilke, K. (2012). Handbuch Katathym Imaginative Psychotherapie. Bern: Hans Huber.